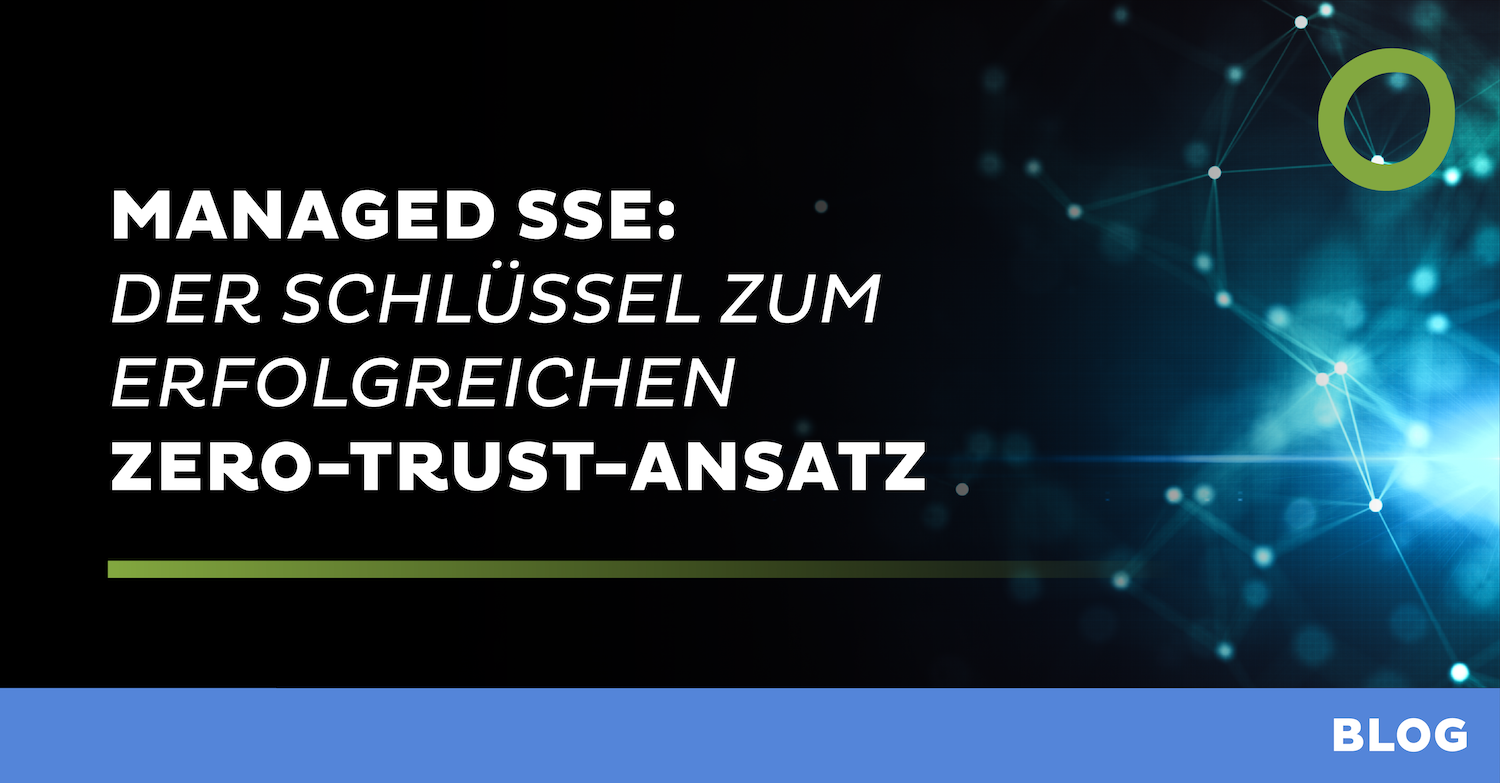Vom Prinzip zur Praxis: Zero Trust im Überblick
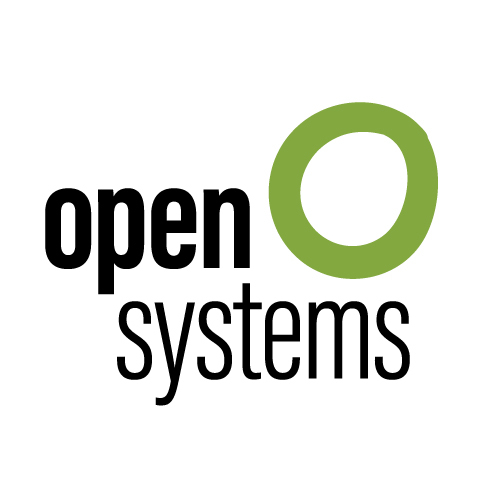
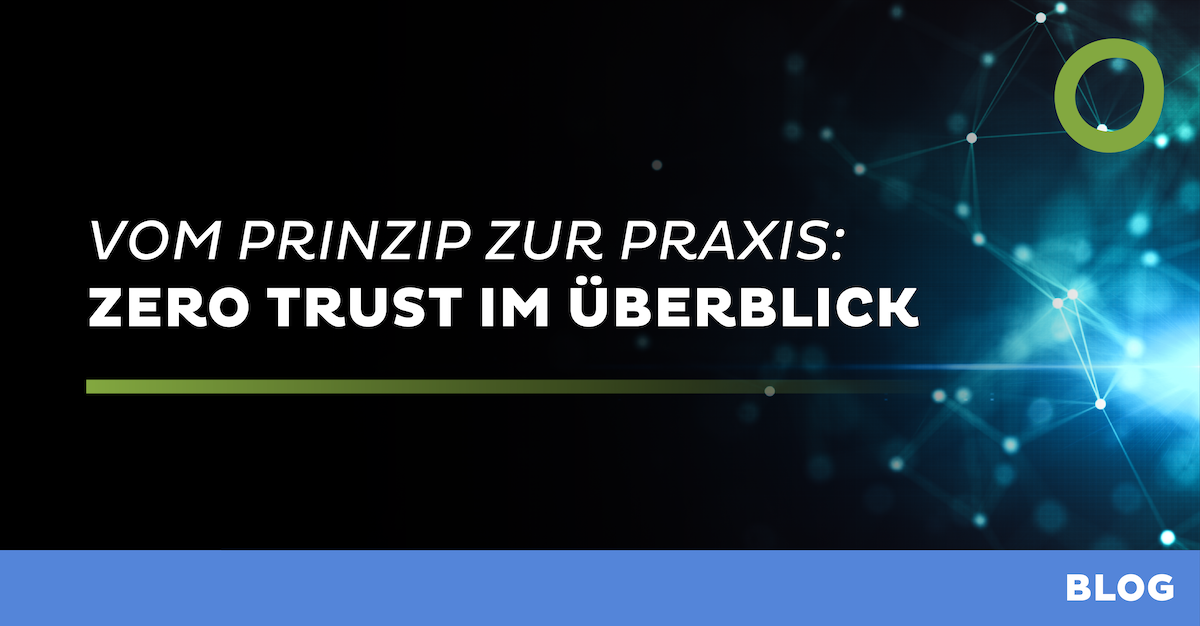
Ein neues Paradigma der Cybersicherheit
Die Zeiten, in denen ein Unternehmensnetzwerk wie eine Burg mit Mauern und Gräben geschützt werden konnte, sind vorbei. Grenzen verschwimmen: Mitarbeitende arbeiten im Homeoffice oder unterwegs, Lieferketten und Partnernetzwerke sind digital integriert, Anwendungen laufen in hybriden Multi-Cloud-Umgebungen. Die alte Logik von „innen ist sicher, aussen ist gefährlich“ funktioniert nicht mehr.
Genau hier setzt Zero Trust an. Der Grundsatz lautet: „Never trust, always verify“. Niemandem und nichts wird per se vertraut – jeder Zugriff auf Daten und Systeme muss kontinuierlich überprüft werden.
Was Zero Trust ausmacht
Zero Trust ist kein einzelnes Produkt, sondern ein Sicherheitsmodell mit klaren Prinzipien:
- Least Privilege: Jeder bekommt nur die minimal notwendigen Rechte.
- Kontextbasierte Zugriffe mit ZTNA: Identität, Gerätezustand, Standort oder Uhrzeit bestimmen, ob ein Zugriff erlaubt wird.
- Kontinuierliche Verifikation: Vertrauen ist nie dauerhaft. Jede Anfrage wird im Hintergrund neu geprüft.
- Mikrosegmentierung: Das Netzwerk wird in kleine Zonen unterteilt, um Angreiferbewegungen einzudämmen.
- Sichtbarkeit & Transparenz: Endpunkte, Anwendungen und Datenströme werden laufend überwacht.
Diese Prinzipien stärken nicht nur die Sicherheit, sondern schaffen auch Nachvollziehbarkeit für Audits und Compliance-Anforderungen (u.a. NIS2).
Mehr als nur ein IT-Thema
Zero Trust betrifft weit mehr als Firewalls oder VPNs. Es ist ein Modell, das Prozesse, Rollen und Abläufe verändert.
Das deutsche Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) spricht vom Unternehmen müssen davon ausgehen, dass Angreifer bereits im Netzwerk sind – und deshalb jeden Zugriff kritisch prüfen. Vertrauen darf nicht vorausgesetzt, sondern muss jedes Mal aufs Neue verifiziert werden.
Der Weg zur Umsetzung
Viele Unternehmen haben begonnen, Zero Trust einzuführen, stehen aber erst am Anfang. Das Zero-Trust-Maturity Model beschreibt mehrere Reifestufen – von ersten Pilotprojekten bis zu einer vollständig integrierten Architektur.
Ein möglicher Fahrplan:
- Fokus setzen: Start mit klar umrissenen Anwendungsfällen, etwa beim Partner- oder Lieferantenzugriff.
- Identitäten ins Zentrum rücken: Identity & Access Management bildet die Basis – idealerweise ergänzt durch Multi-Faktor-Authentifizierung.
- Kontext berücksichtigen: Zugriffe werden dynamisch bewertet statt pauschal freigegeben.
- Integration ins Gesamtmodell: Zero Trust wird Teil einer umfassenden Sicherheitsarchitektur mit Netzwerk-, Cloud- und Applikationsschutz.
- Skalieren & Automatisieren: Nach ersten Erfolgen folgt die Ausweitung auf weitere Nutzergruppen, Geräte und Infrastrukturen.
Zero Trust ist damit eine Reise, kein Ziel – und erfordert interdisziplinäre Zusammenarbeit von IT, Security, Business und Compliance.
Die Rolle von Künstlicher Intelligenz
Mit der zunehmenden Dynamik digitaler Geschäftsmodelle wächst die Bedeutung von Künstlicher Intelligenz (KI). Sie unterstützt Zero Trust dabei, Risiken in Echtzeit zu bewerten:
- KI erkennt Anomalien im Nutzer- und Geräteverhalten.
- Zugriffsrechte können automatisch angepasst oder verweigert werden.
- Bedrohungsinformationen lassen sich schneller auswerten und umsetzen.
Doch KI bringt auch eigene Herausforderungen mit: KI-Systeme und -Agenten greifen selbstständig auf Daten zu und müssen daher wie menschliche Nutzer streng nach Zero-Trust-Prinzipien behandelt werden – inklusive Identitätsprüfung, Minimalrechten und kontinuierlicher Überwachung.
Ausblick: Zero Trust als dauerhafte Strategie
Zero Trust ist kein kurzfristiges Projekt, das einmal umgesetzt und dann abgehakt werden kann. Es ist ein dauerhafter Sicherheitsansatz, der sich parallel zu neuen Technologien und Bedrohungsszenarien weiterentwickelt.
Ob in der Cloud, in hybriden Netzwerken oder im Umgang mit autonomen KI-Systemen – Zero Trust sorgt dafür, dass Sicherheit, Benutzerfreundlichkeit und Geschäftskontinuität in Einklang gebracht werden.
Fazit: Zero Trust ist kein Hype, sondern die logische Antwort auf die digitale Realität. Wer sich frühzeitig auf diesen Weg macht, schafft die Grundlage für eine resiliente und zukunftssichere Sicherheitsarchitektur.
Zero Trust mit Open Systems umsetzen
Die Umsetzung von Zero Trust ist ein strategischer Prozess, der Technologie, Organisation und Kultur gleichermassen betrifft. Viele Unternehmen stehen dabei vor der Herausforderung, unterschiedliche Plattformen, Clouds und Standorte sicher und konsistent einzubinden.
Open Systems unterstützt Organisationen weltweit mit SASE – und Zero-Trust-Lösungen, die Identität, Gerätesicherheit und Kontextinformationen in einem einheitlichen Framework vereinen. Das Ergebnis:
- Sichere Zugriffe für Mitarbeitende, Partner und Lieferanten – unabhängig von Standort oder Endgerät
- Einfachere Compliance dank granularer Zugriffskontrollen und vollständiger Transparenz
- Mehr Benutzerfreundlichkeit durch nahtlose Authentifizierung ohne VPN-Hürden
Mit 35 Jahren Erfahrung in Netzwerksicherheit und einem 24×7-Expertensupport bietet Open Systems Unternehmen die nötige Expertise, um Zero Trust Schritt für Schritt erfolgreich umzusetzen.
Erfahren Sie mehr unter www.open-systems.com
Lassen Sie die Komplexität
hinter sich
Sie möchten auch von der Open Systems SASE Experience profitieren? Unsere Experten helfen Ihnen gern weiter.
Kontakt